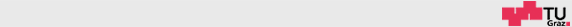

|
HANDWERK
|
| Kennzeichnend für das
traditionelle Handwerk in Österreich und ganz Europa war
die kleinbetriebliche Produktionsweise, die Arbeit in
kleinen, dezentralen Betriebsstätten. Wo der Meister
nicht alleine arbeitete, geschah dies oft im Rahmen von Familienbetrieben. Man beschäftigte
bis ins 18. und 19. Jahrhundert meist kaum mehr als ein
oder zwei Gesellen bzw. Hilfskräfte, wenngleich es
durchaus auch, wie im Bauwesen, größere Betriebe gab.
Zum traditionellen Handwerk gehörte auch, daß die
Gesellen in der Regel im Haus des Meisters aßen und
wohnten. Die Einheit von Arbeiten und Wohnen, auch als
Sozialform des "ganzen Hauses" bezeichnet,
löste sich erst mit der Industrialisierung
im späten 18. Jahrhundert auf. |
| Die Arbeitsteilung war nur
gering ausgeprägt, wenngleich hier vor allem im
großstädtischen Handwerk starke sektorale Unterschiede
bestanden. Demgemäß bildete die Spezialisierung
die sogenannte "Berufsteilung" das Prinzip
handwerklicher Arbeitsteilung und führte zu einer
Auffächerung der Berufe, d.h. einer Vielfalt von
Handwerksberufen, die sich hinsichtlich des verwendeten
Werkzeugs und ihrer Produkte dennoch nicht immer scharf
abgrenzen ließen.Ein weiteres Merkmal des traditionellen
Handwerks ist das starke Gewicht des geregelten Ausbildungsganges, der Lehr- und
Gesellenzeit umfaßte, und seit der Institutionalisierung
der Lehrzeit im Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert
in seinen Grundzügen bedeutend blieb. |
| Schließlich ist noch die korporative
bzw. zünftige Organisation als Charakteristikum zu
nennen. Regional differierend wurden die Korporationen
der Handwerker als, Zunft,
Gilde, Amt, Zeche, Innung, Einung, Gaffel oder
Brüderschaft bezeichnet. Abhängig von den politischen
Rahmenbedingungen gestalteten sich Entwicklung, Formen
und Rechte der Zünfte höchst unterschiedlich. Daneben
spielten sie auch in vielfacher Hinsicht eine Rolle im
religiös-kultischen Leben der Gemeinde. Der Stand der
Handwerker mit seiner Zunftorganisation war auf diese
Weise fest in die feudale Gesellschaft eingebunden.
Diesen zwar untergeordneten aber doch festen Platz in der
ständischen Hierarchie veranschaulicht der hier
abgebildete Ständebaum (324KB). |
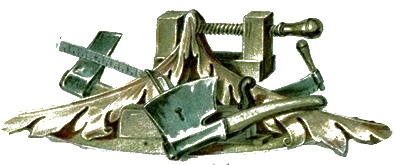
|
|