Der Walzer als Träger einer gesellschaftlichen Revolution
|
| Das Revolutionäre des Walzers bestand in der ekstatischen
Dynamik, welche alle Tänzer ohne Unterschied nach Rang und Stand im
Sog der drehend wirbelnden Masse fortriß. Die Durchsetzung des Walzers
als Modetanz an den Höfen Europas demonstrierte die zunehmend brüchiger
werdende Machtposition traditioneller Herrschaftsschichten. Im Medium des
Tanzes kündigte sich für das Bürgertum und den "vierten
Stand" eine gesellschaftliche Entwicklung an, die politisch noch erkämpft
werden mußte. Der Walzer wurde zum Inbegriff der Revolution und das
Symbol des bürgerlichen Prinzips der "égalité". |
| Der Walzer erforderte außerdem eine enge Tanzhaltung.
Zum erstenmal in der Geschichte des europäischen Gesellschaftstanzes
standen sich Mann und Frau eng gegenüber, umfaßten einander
und drehten sich im ununterbrochenen Wirbel in einen tranceähnlichen
Zustand. Diese als unmoralisch angeprangerte Tanzhaltung bedeutete eine
sexuelle Revolution im Tanz. |
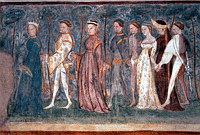 |
Das Ausmaß dieser kulturellen Umwälzung kann erst gänzlich
in Gegenüberstellung des Walzers mit dem höfischen Modetanz,
dem Menuett, verstanden werden, das vor dem Siegeszug des Walzers die Welt
des Tanzes seit dem 17. Jahrhundert beherrschte. Mit dem Menuett und seinen
höchst komplizierten, detailreichen Figur- und Schrittfolgen war die
Trennung zwischen Gesellschaftstanz und den ursprünglicheren Volkstänzen
gänzlich vollzogen, die kulturelle Kluft zwischen den sozialen Klassen
unüberbrückbar. |
Zum Wesen des Menuetts gehören eine strenge Formation
von Tänzern, die den kustvollen Tanz in gemessenen Schritten auf exakten
geometrischen Linien ausführen, aber ebenso ein Publikum, auf das
der Tanz ausgerichtet ist. Wer in welcher Reihenfolge zum Tanz einzog,
war von größter Bedeutung. In der ausgeklügelten Ordnung
und abstrakten Uniformität der Tänzer ist der soziale Status
ausschlaggebend für die Aufstellung im Tanz; die hierarchische Gesellschaftsordnung
wird im Tanz demonstriert.
|
| Ganz anders ist es nun im Walzer, durch den erstmals in der europäischen
Geschichte des Tanzes große Massen von freitanzenden Paaren entstehen;
die Betonung liegt nicht auf Uniformität, sondern im individuellen
Ausdruck. Kompliziert zu lernende Abfolgen des Menuetts ohne Freiraum für
persönliche Ausformung werden durch wenige Grundschritte des Walzers
ersetzt, die dem eigenen Temperament Spielraum lassen. |
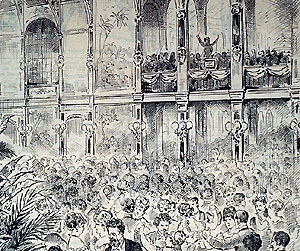 |
Die Tänzer legen beim Eintritt in eine tanzende Menge
ihre soziale Rolle ab, es zählt nur die individuelle Leistung und
Begeisterung im Tanz und nicht der Status in der Gesellschaft außerhalb
des Ballsaals. Der Walzer ist kein Abbild einer existierenden sozialen
Ordnung, noch enthält er wie seine Vorläufer narrative Momente,
er ist als Tanz absolut wie die Kreisform an sich.
|
In dieser Absolutheit als Tanz lag vielleicht auch die
Fähigkeit des Walzers letztlich alle sozialen Schichten gleichermaßen
zu erfassen. Gleichzeitig wird dieses Phänomen von den geistigen und
kulturellen Umwälzungen seit der Französischen Revolution getragen.
In der Kunst kommt es zu einer immer stärkeren Loslösung von
den traditionellen Auftraggebern, ein Kunstmarkt mit den Komponenten "freier
Künstler" und "allgemeiner Geschmack" lösen die
Abhängigkeit von Hof und Kirche. Der "individuelle Stil",
Emotionalismus und die romantische Zuwendung zur übergeordneten Macht
der Natur demonstrierten zunächst die intellektuelle Unabhängigkeit
der Mittelschicht, führten aber weiter zu einem sensiblen Kult des
Individualismus, dem sich ebenso die Oberschicht anschließen konnte.
Der Walzer bot in seiner stürmischen Aufgabe aller Konventionen, dem
Eintauchen in eine wogende Masse die Möglichkeit den neuen Individualismus
aktiv zu leben. Die doppelte Spiralbewegung, die Drehung um die eigene
Achse beim gleichzeitigen Beschreiben eines großen Kreises gleicht
den kosmischen Bahnen der Planeten, im Tanz wird der Mensch ein bewegter
Teil des Universums.
|
[ Zurück ] |
[ Startseite ] |
[ Weiter ]
|