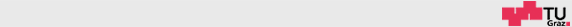
Die Entwicklung des Wiener Walzers
Fortsetzung
|
| Fassungslos über die Tanzwut der Wiener notierte 1802
J.Gerning, ein Besucher der Donaumetropole, in sein Tagebuch: |
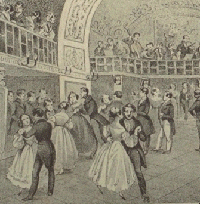 |
"Windig und giftig
ist Wien, sagt das Sprichwort, den häufigen Staub des Kiesel-Bodens
kann manche schwache Brust nicht ertragen; Lungenentzündungen sind
hier nicht selten, doch nicht sehr gefährlich, aber unter 10 bis 11000
Menschen , die hier sterben, ist gewöhnlich der 4. Theil mit Brustkrankheiten
zu Grabe gegangen, woran auch das unmäßige Walzen die Schuld
trägt."
(J.Gerining, Reise durch Österreich und Italien, Frankfurt/Main
1802, 1.Teil., S.30) |
Berichte wie diese zeigen, welch bedeutenden Stellenwert der ekstatische
Tanz für die Wiener Bevölkerung hatte. Aufgrund der erheblich
angestiegenen Anzahl der Tanzpaare in den
Ballsälen
wurde das geordnete Walzen in der Runde zugunsten einer von jedem Tanzpaar
selbständig und individuell gezogenen Kreisbahn aufgegeben, eine Entwicklung,
die sich schon im Langaus angekündigt hatte.
|
 |
| Zur Zeit des Wiener Kongresses hatte der Wiener
Walzer als neuer Modetanz alle Ballsäle erobert. Eine rauschende Ballnacht
folgte der anderen und nicht zuletzt verbildlicht das spöttische Bonmot
"Der Kongress tanzt wohl, aber er schreitet nicht voran" die
Tanzleidenschaft, die zu dieser Zeit einen Höhepunkt erreichte. Schnell
wurde nun der Wiener Walzer auch in Paris Mode, er fand Übernahme
in Opern und etablierte sich mit den Werken Schuberts, Brahms, Chopins
als Konzertwalzer. |
Getragen von den bezaubernden Walzerklängen Joseph Lanners
und Johann Strauß (Vater) befand sich Wien in einem Walzertaumel.
Nicht nur die äußere Tanzgestalt hatte sich bis ins späte
Biedermeier geändert, auch der Inhalt wandelte sich von einen "Außer-sich-Geraten"
in rasendem Wirbel zu einem leidenschaftlichen "Entschweben
in eine bessere Welt". In seiner mitreißenden Musik bot der Walzer
die Flucht vor der Wirklichkeit, wobei die immer aufwendiger werdenden
Ballveranstaltungen im krassen Widerspruch zu den sozialen Verhältnissen
standen.
|
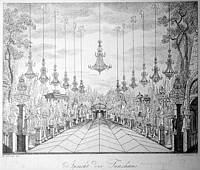 |
| Nicht nur in den Ballsälen feierte der Wiener Walzer
Triumphe, sondern er fand zur Wiener Ringstraßenzeit auch Eingang
in die Traumwelt der Wiener Operette. Der Wiener Walzer hatte seinen phänomenalen
Durchbruch auf alltagskultureller Ebene vollzogen, das Europa des 19. Jahrhunderts
befand sich in einem Walzerrausch, verbunden durch die Musik von Johann
Strauß, die alles zuvor Dagewesene an ekstatischem Ausdruck übertraf.
|
Auch wenn der Wiener Walzer als vermeintlich bereits disziplinierter
Gesellschaftstanz, angesichts der heutigen Tanzkultur, kaum mehr als Träger einer
gesellschaftlichen Revolution
empfunden wird, so hat er doch als Ausdrucksmittel ekstatischer Freude und Ausgelasssenheit
kaum an Stellenwert eingebüßt: In seiner mitreißenden
Beschwingtheit läßt uns der Walzer ins Neue Jahr tanzen, als
krönender Abschluß und immer wieder Neubeginn in fortwährender
Kreisbewegung.
|
|
[ Zurück ] |
[ Startseite ] |
[ Weiter ]
|
|